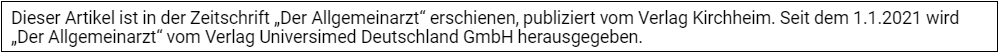Nackenschmerzen machen in der Hausarztpraxis etwa 4 % aller Beratungsanlässe aus. Hausärzte sind hier häufig mit Patienten konfrontiert, die bestimmte diagnostische bildgebende Verfahren und Therapiemaßnahmen einfordern. Dieser Umstand setzt den Arzt oft unter Druck und kann – in Kombination mit dem täglichen Zeitmangel, dem Wunsch nach schnellem Behandlungserfolg und einer langjährigen Routine – für eine mangelnde Umsetzung der Nackenschmerz-Leitlinie sorgen. Das Ergebnis ist häufig eine Über- oder Fehlversorgung der Patienten.
Unter Nackenschmerzen versteht man Schmerzen in dem Gebiet, das cranial durch die Linea nuchalis superior, caudal durch den ersten Brustwirbel und jeweils lateral durch die Ansätze des M. trapezius am Schultergelenk begrenzt wird [21].
Zeitlich erfolgt die Einteilung von Nackenschmerzen in akut, subakut und chronisch [21]. Zusätzlich differenziert man sie nach ihrer Ätiologie. Alle Nackenschmerzen, denen keine raumfordernden, entzündlichen, traumatischen oder systemischen Prozesse zugrunde liegen, werden als nichtspezifisch bezeichnet. Im Gegensatz dazu liegen bei Verdacht auf konkrete organische Ursachen spezifische Nackenschmerzen vor (vgl. Tabelle 1) [3, 21].
Epidemiologie
Während es in anderen Ländern zahlreiche Studien zur Häufigkeit von Nackenschmerzen gibt, mangelt es in Deutschland an einer aussagekräftigen Datenbasis. Die Global Burden of Disease Study ordnete Nackenschmerzen im Jahr 2010 als den vierthäufigsten Grund für Einschränkungen der Lebensqualität ein [18].
Hoy et al. [13] schätzen die Punktprävalenz von Nackenschmerzen auf 0,4 % bis 41,5 % in der Gesamtbevölkerung. Die Neuerkrankungsrate von Nackenschmerzen steigt mit zunehmendem Alter und erreicht einen Peak zwischen 35 und 49 Jahren [13]. Die Prävalenz in Industriestaaten, hier vor allem in städtischen Regionen, wird allgemein höher eingeschätzt [13].
Nackenschmerzen haben meist einen harmlosen Charakter mit hoher spontaner Heilungstendenz. Ähnlich wie Schmerzen in der Lumbalregion können Nackenschmerzen einen episodischen Verlauf über das gesamte Leben eines Betroffenen nehmen und werden von verschiedensten äußeren und persönlichen Faktoren beeinflusst [2, 13]. Während sich akute Zustände innerhalb von zwei Monaten von selbst bessern können, leidet die Hälfte der Patienten weiter an Beschwerden oder bekommt Rückfälle [2]. Betroffene beschreiben dabei Einschränkungen im Alltag (beim Autofahren, bei der Computerarbeit oder der Teilnahme an sozialen Aktivitäten), was wiederum die Belastung durch die Krankheit erhöhen kann [13].
Probleme in der Hausarztpraxis
Ein kausaler Zusammenhang zwischen Befund und beklagten Symptomen lässt sich bei nichtspezifischen Nackenschmerzen selten herstellen [6]. Bildgebende Verfahren dienen deshalb häufig nur dem Bedürfnis von Ärzten und Patienten, organische Ursachen nachzuweisen. Zervikale Spondylosen, Osteoarthrosen oder Bandscheibendegenerationen finden sich jedoch auch bei beschwerdefreien Patienten und können daher meist nicht als alleinige Auslöser für Nackenschmerzen gelten [6].
Nur in weniger als 1 % der Fälle sind hier Zeichen einer gefährlichen Grunderkrankung, wie Tumoren, Infektionen, Arachnoidalblutungen oder Dissektion der A. vertebralis als Ursache nachweisbar [11].
Hausärzte sind oft in der Situation, dass sich subjektive Empfindungen des Patienten von den objektiven Beurteilungen des Arztes unterscheiden [23]. Die Erwartung der Patienten, einen Anspruch auf eine Therapie zu haben, ist äußerst präsent [23]. Ein gleichzeitiger Mangel an körperlicher Selbstkompetenz oder eine Vermeidungshaltung fördern unangemessene Forderungen nach medizinischen Leistungen. Patienten sind meist vom Vorhandensein einer physischen Ursache überzeugt, während psychische Einflussfaktoren nicht in Betracht gezogen oder kategorisch ausgeschlossen werden [23].
Diagnostik
Der strukturierten Diagnostik von Nackenschmerzen liegt eine ausführliche Anamnese sowie eine körperliche Untersuchung zugrunde. Diese geben das Ausmaß des weiteren Vorgehens und des Therapieumfangs vor (Abb. 1) [22].
Red Flags und Yellow Flags
Für die Entscheidung, ob eine Überweisung an einen Facharzt notwendig ist, sind sogenannte Red Flags (RF) heranzuziehen. Diese müssen bei der Anamnese und Diagnostik durch den Hausarzt berücksichtigt werden [2, 3, 23, 24].
Bei RF handelt es sich um Hinweise auf eine spezifische, ernsthafte Pathologie, welche die Ursache für die Symptome des Patienten sein kann (Tabelle 2) [3]. Eine oberflächliche Diagnostik sowie eine Vernachlässigung der Äußerungen des Patienten können hier eine gravierende Unter- oder Fehlversorgung nach sich ziehen [23].
Dies passiert etwa durch ein fehlerhaftes oder unbegründetes Einsetzen invasiver Therapiemaßnahmen, eine Vernachlässigung des Untersuchens von RFs oder eine verspätete beziehungsweise unkommentierte Überweisung des Patienten an einen Facharzt.
Neben RF existieren auch sog. Yellow Flags (YF). Unter YF sind psychosoziale Risikofaktoren zu verstehen, die einen Einfluss auf Krankheitsverlauf und Schmerzwahrnehmung haben können (Tabelle 2). Der Hausarzt sollte für YF sensibilisiert sein, um entsprechend reagieren und mit dem Patienten darüber sprechen zu können [5]. Psychosoziale Kompetenzen sind hierfür notwendig.
Anamnese
Im Gespräch sollte der Arzt vorrangig die Charakteristika der Nackenschmerzen erfassen, wie z. B. den zeitlichen Verlauf der Beschwerden, Schmerzqualität, Lokalisation und etwaige Ausstrahlungen in die Arme [22]. Informationen über frühere Krankheitsepisoden sowie deren Therapien, die Medikamentenanamnese und Komorbiditäten sind zu dokumentieren [22].
Körperliche Untersuchung
Bei der Inspektion sollte vor allem auf funktionelle Fehlstellungen oder schmerzbedingte Haltungen (z. B. Kopfhaltung) geachtet werden. Auch benachbarte Abschnitte der Halswirbelsäule (HWS), wie Kiefergelenk und Schultergürtel, sind zu berücksichtigen. Die Untersuchung der Schulter ist hierbei besonders bedeutsam, da vor allem Tendinitiden und Bursitiden ausstrahlende Schmerzen in die Arme verursachen können und somit schwer von einer Radikulopathie zu unterscheiden sind [22]. Miosis, Ptosis und Enophthalmus können Hinweise auf ein Horner-Syndrom sein [22].
Die Palpation umfasst eine Untersuchung der tastbaren knöchernen Strukturen und des Weichteilgewebes. Ein leichter Druck auf Dorn- und Querfortsätze verursacht normalerweise keine Schmerzen [22]. In der Muskulatur können schmerzhafte Punkte gefunden oder getastet werden (sogenannte Triggerpunkte) [22]. Schwellungen der Lymphknoten sollte der Arzt als Hinweis auf eine infektiöse oder entzündliche Erkrankung berücksichtigen [22]. Die Beweglichkeitsprüfung der HWS umfasst Bewegungen in Reklination, Inklination, Rotation und Seitneigung im Seitenvergleich. Bei ausstrahlenden Schmerzen in die Arme ist gegebenenfalls eine neurologische Untersuchung der Arme (Sensibilität, Motorik, Reflexe) nötig [22].
Bildgebende Verfahren
Man muss ausdrücklich darauf hinweisen, dass bildgebende Verfahren nur bei Verdacht auf RF und somit sparsam einzusetzen sind. Werden Röntgen, MRT und CT als Screening-In-
strument angewandt, kann die Aufmerksamkeit fälschlicherweise auf radiologische Details, z.B. altersentsprechende degenerative Veränderungen, gelenkt werden. Dies kann zu einer Pathologisierung des Patienten beitragen. Bei nicht-traumatischen Nackenschmerzen ist deshalb nach Ausschluss von RF auf eine Bildgebung zu verzichten [22]. Die Indikation für ein bildgebendes Verfahren liegt vor, wenn neurologische Defizite oder radikuläre Schmerzen auftreten oder ein Frakturverdacht vorliegt [22]. All diese Beschwerden können z. B. durch Bandscheibenvorfälle, Foraminalstenosen oder vorangegangene HWS-Traumata (z. B. durch einen Auffahrunfall) ausgelöst werden und erfordern eine weitere diagnostische Abklärung [22].
Nach dem Ausschluss spezifischer Nackenschmerzen beziehungsweise der Überweisung des Patienten an entsprechende Fachärzte steht die Unterstützung des Spontanverlaufs im Vordergrund. Die hausärztliche Behandlung sollte vor allem Aufklärung und Beratung des Patienten, Hilfe zur Beibehaltung der Aktivitäten sowie, falls nötig, eine kurzfristige analgetische Therapie umfassen. Ziel ist es, die Maßnahmen sinnvoll zu begrenzen und gleichzeitig einer Chronifizierung der Erkrankung entgegenzuwirken.
Therapie nichtspezifischer Nackenschmerzen
Die S1-Leitlinie Nackenschmerz [21] listet verschiedene konservative Therapieoptionen für nichtspezifische Nackenschmerzen auf. Aufgrund der weitgehend unzureichenden Studienlage lässt sich der Stellenwert der genannten Therapieoptionen gegenüber Spontanverlauf, Placeboeffekten und therapeutischer Zuwendung jedoch nicht eindeutig benennen.
Medikamentöse Behandlung
Dass Relaxantien eine schmerzlindernde Wirkung auf Nackenschmerzen haben, ist nur durch eine schwache Evidenz belegbar [1]. Aus diesem Grund und wegen der bekannten sedierenden Nebenwirkungen vieler Relaxantien empfiehlt die Leitlinie keine Gabe bei nichtspezifischen Nackenschmerzen [21]. Für die nichtsteroidalen Antirheumatika (NSAR) gibt es widersprüchliche Hinweise, dass sie bei akuten Nackenschmerzen schmerzlindernd wirken können [19, 26].
Die Leitlinie empfiehlt dennoch eine kurzfristige Gabe über maximal zwölf Wochen, wobei Patienten über mögliche Nebenwirkungen aufgeklärt werden sollten [21].
Mobilisation und Manipulation
Die Leitlinie empfiehlt Mobilisierung und Manipulation bei akuten, subakuten und chronischen Zuständen [21]. Aufgrund der Studienlage lässt sich jedoch sagen, dass hier die Art der Anwendung von entscheidender Bedeutung ist. Bei akuten Nackenschmerzen beschreibt ein Review, dass multiple zervikale Manipulationen effektiver in der Schmerzlinderung sein können als die Medikation [9]. Bei chronischen Nackenschmerzen scheint eine einmalige zervikale Manipulation nur zur kurzfristigen Schmerzlinderung (< 6 Monate) beizutragen [9].
Es gibt zudem moderate Evidenz, dass eine Kombination aus Manipulation und verschiedenen Mobilisationstechniken chronische Schmerzen langfristig reduzieren und die Funktion verbessern kann [4].
Akupunktur
Für die in der Leitlinie empfohlene Akupunktur bei chronischen Nackenschmerzen findet sich in der Literatur nur schwache Evidenz für eine kurz- bis mittelfristige schmerzlindernde Wirkung auf Beschwerden, die im Zusammenhang mit chronischen Nackenschmerzen stehen [21, 27].
Injektionen
Die Leitlinie empfiehlt keine Injektion von Lokalanästhetika bei Nackenschmerzen [21]. Die widersprüchliche Studienlage bezüglich in-tramuskulärer und epiduraler Injektionen sowie hinreichend beschriebene Komplikationen durch Injektionen (z. B. Infektionen) unterstützen diese Empfehlung [19, 21].
Bewegungstherapie und Physiotherapie
Die Leitlinie rät von einer Ruhigstellung durch immobilisierende Maßnahmen ab und empfiehlt eine frühe Wiederaufnahme von Aktivität schon in der akuten Phase [21]. Welche Aktivitäten bei akuten Nackenschmerzen konkret schmerzlindernd sind, lässt sich jedoch nicht eindeutig sagen. Aktuelle Studien fanden zudem nur schwache Evidenz dafür, dass Bewegungstherapie bei akuten Nackenschmerzen überhaupt schmerzlindernd wirkt [8]. Bei subakuten und chronischen Nackenschmerzen spricht eine starke Evidenz für einen multimodalen Therapieansatz. Eine Kombination aus Bewegungstherapie und Mobilisation scheint bei chronischen Zuständen erfolgreicher in der langfristigen Schmerzlinderung zu sein als die Bewegungstherapie allein [4, 12, 14]. Hinsichtlich achtsamkeitsorientierter Bewegungsprogramme wie Yoga gibt es wiederum nur schwache Evidenz für eine kurz- bis mittelfristige Linderung chronischer Nackenschmerzen [8, 17].
Für sonstige physiotherapeutische Maßnahmen lässt sich keine bis eine schwache Evidenz bezüglich der Wirksamkeit nachweisen. Massageanwendungen, so zeigten Reviews, haben keine signifikante Verbesserung der Schmerzintensität über einen Tag hinaus [15, 25].
Auch andere Maßnahmen wie die manuelle Traktion, die Elektrotherapie, die craniosacrale Therapie oder das Schröpfen zeigen lediglich eine schwache Evidenz für eine langfristige Schmerzlinderung [7, 10, 16, 20].
Interessenkonflikte: Die Autoren haben keine deklariert.
Erschienen in: Der Allgemeinarzt, 2019; 41 (20) Seite 38-42