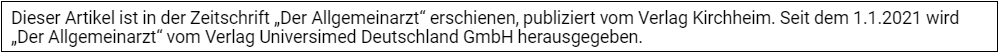Ältere Menschen leiden besonders häufig unter Venenerkrankungen. Für Krampfadern (Varicosis) sind heute verschiedene Therapieansätze möglich – neben konventionellen Verfahren wie der Crossektomie kommen thermisch ablative Therapien wie die Laserung zum Einsatz. Beim Ulcus cruris gehört die Kompression zur Basistherapie.
Für die phlebologische Betreuung im Alter ergeben sich drei Schwerpunkte: die Behandlung des Ulcus cruris venosum, der Varikosis und der Thrombose, die nicht zuletzt aufgrund der zunehmenden Häufigkeit von Krampfadern mit steigendem Alter öfter auftritt.
Therapie der Varikosis
Zahlreiche neue Therapieoptionen für die Varikose sind in den letzten Jahren entwickelt worden, was besonders für die Behandlung der Vena saphena magna und der Vena saphena parva relevant ist. Als Alternative zur konventionellen Crossektomie und Stripping-Operation sind die endovaskulär thermische Ablation (Laser- oder Radiofrequenzkatheter) und die Schaumsklerosierung zu nennen. Bei den drei Therapieverfahren zeigt sich, dass bei der Schaumsklerosierung nach fünf Jahren signifikant mehr Rezidive nachweisbar sind als nach Crossektomie und Stripping auf der einen und Laserablation auf der anderen Seite [8]. Diese Studie sowie andere Erhebungen machen jedoch deutlich, dass die Schaumsklerosierung sehr wohl in der Lage ist, auch bei Stammvenen mit beträchtlichem Kaliber Refluxe auszuschalten und diesen Zustand über ein Jahr zu erhalten: Nach einjähriger Nachbeobachtung zeigten sich keine signifikanten Unterschiede bezüglich klinisch relevanter Refluxe nach Schaumsklerosierung im Vergleich zu den operativen bzw. thermisch ablativen Eingriffen [8]. Nichtoperative Verfahren stellen also gerade bei älteren Menschen, die nicht operiert werden können oder wollen, eine sinnvolle Alternative dar – vor allem, wenn Hautkomplikationen bis zum Ulcus cruris zur Abheilung gebracht bzw. Rezidive verhindert werden sollen. Insbesondere bei dickeren Saphenavenen kommt es nach der klassischen Crossektomie und Strippingoperation seltener zu Rezidiven als nach thermisch ablativen Verfahren wie Lasereingriffen [9, 10].
Therapie des Ulcus cruris
Zur Basistherapie des Ulcus cruris venosum gehört die Kompression, die Sanierung der Varikose und die Lokaltherapie. Die Kompressions- und die kausale Therapie erreichen ein sehr hohes Evidenzniveau. So hat in aktuellen Leitlinien die Kompressionstherapie höchste Empfehlungsstärken und beste Evidenzlevel [1]. Alle anderen lokalen Therapieformen zeigten geringere Evidenzlevel und hatten oft auch schwächere Empfehlungsgrade (Tabelle 1).
Dabei ist nicht nur geklärt, dass die Kompressionstherapie beim Ulcus cruris venosum wirksamer ist als überhaupt keine Kompression [2]. Es gibt zudem hochevidente Aussagen dazu, welche Formen der Kompressionstherapie zu bevorzugen sind. So ist die Zeit bis zur Abheilung unter Vierlagenverbänden etwa 30 % kürzer als unter Kurzzugverbänden [3]. Ein gewisser Nachteil der Vierlagenverbände ist die relativ große Dicke des Verbandes. Hierdurch wird die Beweglichkeit im Sprunggelenk eingeschränkt und die Patienten haben nicht selten Probleme, normale Schuhe über dem Verband zu tragen. Vor diesem Hintergrund ist es wichtig, dass die Wirksamkeit von Zweikomponentenverbänden nicht schlechter ist als die von Vierkomponentenverbänden [2]. Zugeständnisse an den Patientenkomfort sind also durchaus möglich.
Interessant ist nun, welche Bandagen innerhalb der Mehrkomponenten- und Mehrlagenverbände verwendet werden sollten. Gerade in Deutschland war es für viele Jahre unüblich, andere Bandagen als Kurzzugbinden mit geringer Elastizität zu verwenden. Mehrere Studien belegen allerdings bald, dass sich die Abheilungszeit in Dreikomponentenverbänden sogar verbessert, wenn eine elastische Bandage innerhalb dieser Verbände verwendet wird [2].
Bei Patienten mit Ulcus cruris venosum lassen sich auch Kompressionsstrümpfe einsetzen. Diese zeigen eine bessere Wirkung als Kompressionsverbände mit Kurzzugbandagen [4]. Für manche ältere Patienten allerdings kann trotz der Verwendung von Anziehhilfen das Anziehen und Ausziehen von Kompressionsstrümpfen ein Problem sein, weshalb sie Kompressionsbandagen bevorzugen. Hier konnte gezeigt werden, dass anders als Einkomponentenverbände mit Kurzzugbinden Vierlagenverbände modernen Kompressionsstrümpfen nicht unterlegen sind [5]. Aktuelle Studien demonstrieren auch die Wirksamkeit von Gleithilfen und von Gestellen als Anziehhilfen [6]. Es wurde aber auch deutlich, dass nicht jeder Patient mit jeder Anziehhilfe zurechtkommt. Ebenso wie Kompressionsstrümpfe können auch die Anziehhilfen zulasten der gesetzlichen Krankenkassen verordnet werden.
Bei allen Patienten mit Ulcus cruris venosum ist zu prüfen, inwieweit eine Sanierung der Varikose möglich ist. Die Häufigkeit der Ulkusrezidive kann durch Varizensanierungen – selbst bei Patienten mit postthrombotischen Syndromen und irreparablen Schäden der tiefen Leitvenen – deutlich gesenkt werden [7]. Hier entfaltet die chirurgische Sanierung der Refluxe über viele Jahre noch signifikante Effekte. In einer prospektiven Follow-up-Studie kam es nach durchschnittlich 97 Monaten nach Varizenchirurgie bei 48,9 % der nachuntersuchten Patienten zu einem Rezidiv im Vergleich zu 94,3 % bei rein konservativ behandelten Patienten.
a) Beim Ulcus cruris venosum ist die Kompressionstherapie die Basis der Behandlung
mit hohen Evidenzleveln und starken Empfehlungsgraden.
b) Mehrkomponentenverbände und Kompressionsstrümpfe sind gegenüber
Einkomponentenverbänden zu bevorzugen
c) Oft ist die Verordnung von Strumpfanziehhilfen für Kompressionsstrümpfe erforderlich.
d) Refluxsanierungen können über viele Jahre das Rezidivrisiko des Ulcus cruris venosum senken
e) Für die Therapie der Varikose gibt es unterschiedliche Verfahren:- Vorteil Laser-/Radiofrequenzablation: weniger schmerzhaft in den ersten Tagen nach dem Eingriff.
- Vorteil der Crossektomie und Stripping-Operation: geringere Rezidivrate nach fünf Jahren als bei endovenös thermisch ablativen Verfahren.
- Vorteil Schaumsklerosierung: sehr preiswertes und wenig invasives Verfahren, das gerade bei älteren Patienten hohe Akzeptanz hat
Interessenkonflikte: Der Autor hat keine deklariert.
Erschienen in: Der Allgemeinarzt, 2016; 38 (17) Seite 40-42