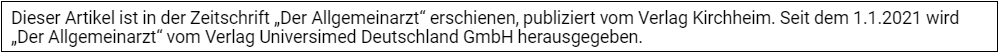Verletzungen älterer und hochbetagter Menschen beschäftigen heutzutage die Unfallchirurgen in besonderem Maße. Als Ursache dominieren dabei Stürze, denen eine ganze Reihe möglicher Ursachen zugrunde liegen. Um langwierige Folgen zu verhindern, ist auch der Hausarzt gefragt, nicht nur in der postoperativen Nachbetreuung, sondern auch bei der Aufdeckung von Risikofaktoren für einen Sturz.
Gerade die Unfallchirurgie befindet sich durch die tägliche Arbeit mit hochbetagten Patienten in einem Wandel. Während die Ursprünge der Unfallheilkunde geprägt waren von jüngeren Patienten, die sich durch Arbeits- oder Verkehrsunfälle verletzt hatten, oder durch die unzähligen Kriegsverletzten des vorigen Jahrtausends, beschäftigt sich die Unfallchirurgie des 21. Jahrhunderts zunehmend mit Verletzungen des älteren Patienten. Die proximale Femurfraktur ist mit über 108.000 Fällen eine der häufigsten Primärdiagnosen bei über 65-jährigen Patienten in Deutschland [1].
Statistisch gesehen stürzt etwa ein Drittel aller Menschen im Alter über 70 Jahre mindestens einmal pro Jahr, wobei 10 – 20 % der Stürze zu ernsthaften Verletzungen führen [2].
Die daraus resultierenden Verletzungsfolgen haben in vielen Fällen einen erheblichen Einfluss auf die Lebensqualität der Patienten und hohe gesundheitsökonomische Relevanz [3].
Die Ursachen für Frakturen im Alter sind dabei oft multifaktoriell. Häufig verursacht schon ein niedrigtraumatisches Ereignis wie ein Stolpersturz aus dem Stand eine Fraktur bei älteren Menschen. Aber auch internistische Sturzursachen wie kardiale Ereignisse, Schwindel oder ein geminderter Allgemeinzustand aufgrund eines Infekts (z. B. Harnwegsinfekt) können zu einem Sturz führen. Unter einer Fragilitätsfraktur hingegen ist eine Fraktur ohne adäquates (Hochenergie-)Trauma zu verstehen, die auch spontan im Alter bei fortgeschrittener Osteoporose auftreten kann und starke Beschwerden verursacht [4].
Der hier beispielhaft gezeigte klinische Verlauf einer Patientin mit multiplen Stürzen und Verletzungsfolgen über einen Zeitraum von drei Jahren verdeutlicht die Besonderheiten älterer unfallchirurgischer Patienten und die herausgehobene Bedeutung einer spezialisierten medizinischen Versorgung.
Die Patientin war beim Gehen am Rollator weggerutscht und auf die linke Seite gestürzt. Die radiologische Diagnostik zeigte eine pertrochantäre Femurfraktur vom AO-Typ 31-A2.2. Aufgrund der Frakturentität wäre klassischerweise die Versorgung mittels einer geschlossenen Reposition und eine intramedulläre Osteosynthese indiziert gewesen. Im präoperativen Aufklärungsgespräch klagte die Patientin jedoch über seit länger bestehenden Schmerzen im Hüftgelenk aufgrund einer Coxarthrose. Wegen dieser Beschwerdesymptomatik wurde von einer Marknagelosteosynthese besser Abstand genommen, da nach dieser weiterhin mit coxarthrotischen Beschwerden gerechnet werden musste. Stattdessen erfolgte die Implantation einer Revisionslangschaftendoprothese.
Die endoprothetische Versorgung in solchen Fällen sollte unter Berücksichtigung der aktuellen Literatur zwar klar Einzelfällen vorbehalten sein, dennoch konnte die Patientin hier nach der definitiven operativen Versorgung zügig mobilisiert werden. Nach Abschluss der geriatrischen Rehabilitation war sie wieder schmerzfrei am Rollator mobil.Ältere Patienten weisen zudem häufig viele Besonderheiten auf, welche die Gefahr von Stürzen begünstigen und spezifische Reaktionsmechanismen während des Sturzgeschehens verlangsamen können. Beispielhaft sind hier die Folgen einer Polypharmazie (über fünf einzunehmende Präparate pro Tag) im Rahmen geriatrischer Therapien zu nennen, aber auch Mangelernährung oder ein gestörtes Volumen-/Elektrolytgleichgewicht [5]. Des Weiteren wird die Aktivität betagter Patienten oft von einer Sarkopenie (Muskelschwund) und internistisch/neurologischen Begleiterkrankungen (Diabetes mellitus, Demenz oder Morbus Parkinson) beeinträchtigt.
Ein in der Bevölkerung weithin unterschätztes und dabei sehr verbreitetes Leiden ist die Osteoporose (vgl. Fallbeispiel). Etwa zwei Drittel der über 75-Jährigen sind betroffen (circa 60 %, darunter vor allem Frauen) [6]. Nicht nur die signifikant reduzierte Knochenqualität erhöht hier das Frakturrisiko, sondern es kommt auch zu einer deutlich verzögerten Frakturheilung.
Gerade wegen dieser Herausforderungen ist es in der Alterstraumatologie nötig, mit speziellen Konzepten und im interdisziplinären Kontext eine rasche, belastungsstabile Versorgung zu erreichen, um die Patienten möglichst ohne Verzögerung zu remobilisieren. So ließ sich bei einer Fraktur im Bereich des proximalen Femurs ein klarer Zusammenhang zwischen einer postoperativen Mobilitätseinschränkung und einer einhergehenden signifikant erhöhten Mortalität aufzeigen [7, 8]. Dies verdeutlicht die Relevanz eines interdisziplinären Behandlungskonzepts, bei dem nicht nur die Therapie der Begleiterkrankungen wesentlich ist, sondern vor allem auch die Mobilisierung unter physiotherapeutischer Anleitung einen großen Stellenwert einnimmt.
Um hier die Versorgung älterer Patienten zu verbessern, treibt die Deutsche Gesellschaft für Unfallchirurgie die Etablierung von Alterstraumazentren voran. Hier wird in einem interdisziplinären und interprofessionellen Behandlungsansatz die Versorgung gemeinsam von Unfallchirurgen, Geriatern, Physio- und Ergotherapie, Sozialdienst und Pflege durchgeführt. Diese interdisziplinäre Zusammenarbeit verbessert nachweislich das Patientenoutcome [9].
So ist neben der Frakturversorgung auch die Behandlung von Komorbiditäten und die Prävention von Komplikationen im Behandlungsverlauf essenziell. Zudem gilt die Umsetzung von Sekundärpräventionsmaßnahmen wie die Sturzursachenabklärung als wichtiger Teil der Behandlung alterstraumatologischer Patienten. Gerade bei der Abklärung der Sturzursache zeigt das Comanagement durch den interdisziplinären und interprofessionellen Ansatz seine Stärken.
Häufige Probleme in der Alterstraumatologie
Perioperative Probleme beim alterstraumatologischen Patienten
Im Rahmen der prä-, peri- und postoperativen Versorgung alterstraumatologischer Patienten müssen einige Besonderheiten beachtet werden. Behandlungsziel ist neben der schnellstmöglichen Wiedererlangung von Mobilität unter Vollbelastung (!) auch die adäquate Rückkehr zu normalen und vorher gelebten Alltagsaktivitäten.
Hier ist zu beachten, dass beim alterstraumatologischen Patienten die Grenzen zwischen der normalen Organphysiologie und einer altersbedingten Einschränkung der Organfunktion fließend sind. Physiologische Anpassungsprozesse laufen deutlich langsamer ab und die Reaktion auf externe Stressoren ist wesentlich sensibler. Dies ist auch durch die Reduktion der Muskelmasse (Sarkopenie) erklärbar [10]. Ältere Patienten sind dadurch postoperativ deutlich vulnerabler und einem erhöhten perioperativen Risiko ausgesetzt, was auch die Wahl des Narkoseverfahrens erheblich beeinflusst. Dazu läuft aktuell eine multizentrische Studie, die verschiedene Narkoseverfahren beim älteren Hüftfrakturpatienten vergleicht ( http://www.ihope-trial.org ).
Besonders riskant wird es, wenn die Patienten schon vor der Verletzung unter einer Gebrechlichkeit (Frailty) litten. Dieser Begriff soll die Komplexität der alterstraumatologischen Patienten und aller relevanten Komorbiditäten zusammenfassen [11]. So kann die "Frailty" die Sterblichkeit von Patienten wesentlich besser vorhersagen als die bloße Fixierung auf das chronologische Alter [12]. Aufenthaltsdauer und Krankenhaussterblichkeit steigen ebenfalls mit zunehmender Ausprägung der Gebrechlichkeit deutlich an, während die Wahrscheinlichkeit einer Entlassung nach Hause entsprechend sinkt [13]. Studien konnten hier zeigen, dass bei Patienten nach einer Hüftfraktur die Sterblichkeit bei 10 bis zu 50 % liegt. Rüstige Senioren haben hierbei mit 10 % das geringste Risiko, während dieses bei schon vorher eingeschränkten Heimbewohnern bei bis zu 50 % liegt. Des Weiteren ist das Risiko einer postoperativen Pflegebedürftigkeit massiv erhöht und vergleichbar mit dem statistischen Risiko des Pflegebedarfs nach einem Schlaganfall [14, 15].
Zur frühestmöglichen Identifikation dieser multimorbiden, geriatrischen Patienten hat sich das sogenannte ISAR-Screening (Identification of Seniors At Risk) etabliert [16].
Probleme in der postoperativen Phase
Neben der Frühmobilisation und gegebenenfalls Anpassung einer Osteoporosetherapie haben das Sturzassessment und daraus folgende Empfehlungen im Rahmen der geriatrischen Nachbehandlung eine weitere wesentliche Bedeutung. Mit spezifischen Übungsanleitungen und Aufklärungsarbeiten kann den Patienten, den Betreuern und den Angehörigen dabei ein Instrument an die Hand gegeben werden, mit dem sich nachweislich weitere Sturzereignisse und konsekutiv Folgefrakturen minimieren lassen [17].
Einen hohen Stellenwert in der postoperativen Nachbetreuung muss auch das Delir-Management haben. Hier zeigen sich ältere Patienten sehr vulnerabel. Vor allem auf die Delir-Prophylaxe sollte man Wert legen, da die beste Therapie die Vermeidung eines solchen Zustands ist [5, 18].
Neben der medikamentösen Behandlung sollte der Fokus auch auf räumlichen Maßnahmen liegen. So lässt sich schon durch eine Uhr oder einen Kalender ein Delir positiv beeinflussen oder gar vermeiden [19]. Auch die Flüssigkeitszufuhr und die Ernährung spielen in diesem Kontext eine wichtige Rolle. Bei vielen älteren Patienten besteht keine ausreichende Kalorienzufuhr mehr und es bedarf der Gabe einer hochkalorischen Zusatznahrung. Nach dem Klinikaufenthalt sollte hierauf ebenso besonders geachtet und die Patienten als auch ihre Angehörigen für eine ausreichende Flüssigkeits- und Kalorienaufnahme sensibilisiert werden. Ergänzend kann ein spezielles Screening, wie der Geriatric Nutritional Risk Index, hilfreich sein [20].
Weiterbetreuung und Osteoporosemanagement
Neben der stationären Therapie mit dem primären Ziel der Belastungsstabilität und Mobilisierung der Patienten nimmt die ambulante Weiterbetreuung einen elementaren Stellenwert in der Alterstraumatologie ein. Diese entwickelt sich oft zu einer schwierigen Schnittstelle, da hier eine enge Koordination zwischen Chirurg, Hausarzt und gegebenenfalls weiteren Spezialisten wie Endokrinologen oder Zahnärzten notwendig ist.
Das Vorliegen einer Fragilitätsfraktur ist der größte Risikofaktor für weitere Frakturen, mit wiederum extrem hohen Morbiditäts- und Mortalitätsraten [4]. Deshalb hat die Abklärung und gegebenenfalls die Einleitung einer Osteoporosetherapie hohe Priorität. Eine adäquate Behandlung der Osteoporose erhalten nur etwa 11 – 16 % aller Frauen und lediglich 3 – 4 % aller Männer [21].
Um hier bestehende Defizite in der Therapieeinleitung, aber auch in der Adhärenz zu fokussieren, wurde von spezialisierten Zentren ein Fracture Liaison Service (FLS) initiiert. Bei einem FLS handelt es sich um eine Netzwerkstruktur, die durch einen Koordinator organisiert wird und die eine individuelle Sicherung der Diagnostik und der Behandlung einer Osteoporose über den stationären Aufenthalt hinaus sichern soll. Dieser Service soll die im deutschen Gesundheitswesen immer wieder vorhandene Schnittstellenproblematik ambulant/stationär überwinden und dabei ein Ansprechpartner über die Sektorengrenzen hinweg sein – für Patienten und für Ärzte [22]. Durch die zentrale Koordination soll die Therapieadhärenz gesteigert und so die Sekundärprophylaxe besser werden. Studien konnten hier eine signifikante Verbesserung mit einer reduzierten Refrakturrate zeigen [23]. Bislang beschränkt sich dieses Modell in Deutschland aber noch auf wenige Zentren und Modellregionen.
Um den Patienten möglichst frühzeitig zu therapieren, sollte man in der Regel eine Osteoporose-Basistherapie nach Durchführung eines spezifischen Labors schon während des stationären Aufenthalts beginnen [6]. Bei ausreichend hohem Vitamin-D-Spiegel kann eine signifikant bessere Frakturheilung und eine Reduktion weiterer Frakturen nachgewiesen werden [24]. Ebenso ist eine kalziumreiche Ernährung, z. B. durch milchhaltige Produkte, sicherzustellen.
Hier kommt der ambulanten Weiterbetreuung und der engmaschigen Kontrolle durch den Hausarzt eine entscheidende Rolle zu, vor allem weil in Deutschland noch keine flächendeckende Versorgung mittels FLS gegeben ist. Seitens des Hausarztes sollte nicht nur eine Kontrolle der eingeleiteten Basistherapie und des Vitamin-D-Spiegels erfolgen, sondern auch die weitere Beratung und Einleitung spezifischer Therapiemaßnahmen. Hier ist – je nach Befund – in einigen Fällen auch eine weiterführende endokrinologische Abklärung notwendig, die der Hausarzt begleiten sollte.
Hand in Hand und gemeinsam mit allen Spezialisten sollte dann die passende Auswahl und Einleitung der Osteoporosetherapie beginnen. Heute ist eine Vielzahl von Präparaten verfügbar. Besonders bei kognitiv eingeschränkten und pflegebedürftigen Patienten kann die quartalsweise oder halbjährliche Applikation von spezifischen Osteoporosepräparaten die Therapieadhärenz nachweislich steigern.
Interessenkonflikte: Die Autoren haben keine deklariert.
Erschienen in: Der Allgemeinarzt, 2020; 42 (11) Seite 14-17