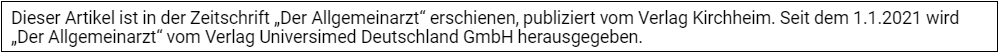Ist es von Bedeutung, ob der Patient mit Asthma oder COPD, der Ihnen gegenübersitzt, weiblich oder männlich ist? Tatsächlich gibt es Unterschiede in Bezug auf Ätiologien, Symptommuster, Therapien und Compliance. Dieses Wissen hilft dem Arzt, den Verlauf besser prognostizieren zu können und seine Therapie anzupassen. Anhand ambulant häufig vorkommender pneumologischer Erkrankungen werden im folgenden Beitrag die wichtigsten Unterschiede dargestellt.
Asthma bronchiale
Asthma bronchiale ist eine häufig vorkommende chronisch entzündliche Erkrankung der Bronchien und ist gekennzeichnet durch eine zeitweise auftretende, reversible Obstruktion der Atemwege sowie eine bronchiale Hyperreagibilität [3]. Die Genese des Asthma bronchiale ist bis heute nicht vollständig geklärt. Es wird ein komplexes Zusammenspiel von genetischen und exogenen Faktoren wie z. B. sozioökonomischer Status und Umweltnoxen angenommen [26].
- Begünstigender Faktor: weibliche Sexualhormone
- Frauen nehmen die Symptome des Asthmas stärker wahr als Männer, zeigen eine höhere bronchiale Hyperreagibilität und sind empfindlicher gegenüber Zigarettenrauch
- Frauen erleiden häufiger schwere Asthma-Exazerbationen als Männer
Bereits im Kindesalter sind Geschlechterunterschiede bezüglich der Prävalenz der Erkrankung zu bemerken: In der weltweit durchgeführten ISAAC-Studie fiel eine erhöhte Prävalenz von Asthma bei Jungen im Vergleich zu Mädchen bei den 6- bis 7-Jährigen auf. Bei den 13- bis 14-Jährigen waren mehr Mädchen als Jungen erkrankt. Als Ursachen hierfür wurden zum einen anatomische Unterschiede wie z. B. engere Durchmesser der Bronchien bei präpubertären Jungen im Vergleich zu Mädchen angenommen. Zum anderen spielen wohl hormonelle Einflüsse bei jungen Heranwachsenden eine Rolle [1, 16].
Häufigkeitsumkehr in der Adoleszenz
Im Erwachsenenalter sind Frauen häufiger betroffen als Männer. Insgesamt ist bei weiblichen Asthma-Patienten die Symptomlast (Husten, Atemnot, Giemen) höher und die krankheitsbezogene Lebensqualität geringer als bei männlichen Patienten [21]. Leider wird bei Frauen Asthma seltener bzw. später erkannt als bei Männern und auch später eine adäquate Therapie eingeleitet. Frauen werden aufgrund einer Exazerbation des Asthma bronchiale häufiger hospitalisiert als Männer und sind in der asthmabezogenen Sterblichkeit im Nachteil [22]. Gerade in der prämenstruellen Phase kommt es bei Asthmatikerinnen zu gehäuften Aggravierungen ihrer Symptome. Es wird angenommen, dass die bronchiale Hyperreagibilität durch einen erhöhten Östrogenspiegel begünstigt wird. Ebenso gibt es Hinweise für einen protektiven Effekt des Testosterons auf die Bronchien. Therapeutisch haben diese Erkenntnisse bisher keine Relevanz [2, 17, 19].
Auch in der Therapie des Asthma bronchiale sind Geschlechterunterschiede von Bedeutung. Männer nehmen Asthmaschulungen seltener wahr als Frauen, außerdem benutzen sie seltener ein Peak-Flow-Meter zur Selbstkontrolle. Es konnte beobachtet werden, dass Männer in der Handhabung der inhalativen Therapie unabhängig vom Device effizienter waren. Frauen hielten während der Anwendung der inhalativen Therapie den Atem häufig zu kurz (< 10 Sek.) an [14]. Im Übrigen zeigten Frauen eine höhere Skepsis gegenüber einer Steroidtherapie aufgrund der Angst vor Nebenwirkungen. Bei Einnahme oraler Steroide neigten Frauen eher zu Nebenwirkungen wie ungewollter Gewichtszunahme und Verminderung der Knochensubstanz [6]. Männer zeigen bei der Anwendung inhalativer Steroide ein besseres Ansprechen als Frauen [9].
COPD
Die chronisch-obstruktive Lungenerkrankung gehört weltweit mit zu den häufigsten Erkrankungen. Man nimmt an, dass COPD im Jahre 2030 eine der Haupttodesursachen sein wird. Aktiver Tabakkonsum ist der wesentlichste ätiologische Faktor, aber auch andere Risiken wie Passivrauchen, Umweltgifte, Feinstaubbelastung und inhalative Noxen am Arbeitsplatz können wesentliche Ursachen sein. Die Diagnosestellung erfolgt mittels Anamnese und Spirometrie, aber auch bei beschwerdefreien Patienten können die Lungenfunktionstests schon pathologisch ausfallen. Als chronische Erkrankung gibt es für die COPD keine Heilungsmöglichkeit, allerdings können medikamentöse und nicht-medikamentöse Therapien das Fortschreiten verhindern und die Symptome verbessern. Die Prävalenz und Mortalität der COPD haben in den letzten Jahrzehnten für Frauen stärker zugenommen als für Männer. Ursächlich hierfür ist vor allem der gesteigerte Nikotinkonsum der Frauen in den letzten Jahrzehnten, allerdings werden weitere Faktoren wie anatomische und hormonelle Unterschiede zwischen Männern und Frauen, eine erhöhte Empfindlichkeit gegenüber inhalativen Noxen für Frauen und unterschiedliches Verhalten in Bezug auf die verfügbaren Therapien vermutet. Die Mortalität der COPD ist vor allem aufgrund der zahlreichen Komorbiditäten erhöht, vor allem kardiovaskuläre Erkrankungen und Krebserkrankungen. COPD-Patientinnen haben allerdings eine geringere kardiovaskuläre Komorbidität und seltener Diabetes mellitus. Osteoporose und Depression sind hingegen häufiger.
- Frauen erleben die Symptome der COPD als gravierender
- Frauen haben eine höhere Exazerbationsrate mit Krankenhausaufenthalt als Männer
- Rauchverzicht verbessert bei COPD-Patientinnen die Lungenfunktion stärker als bei Männern, allerdings ist die Bereitschaft zum Rauchverzicht niedriger
- Bei Patienten mit COPD und LTOT überleben Frauen länger als Männer
Unterschiedliche Wahrnehmung von Beschwerden
Große Unterschiede zeigen sich in der Symptomlast zwischen COPD-Patientinnen und -Patienten: Während sich die männlichen Patienten vor allem durch eine erhöhte Sputumproduktion belastet fühlen, erleben betroffene Frauen eine signifikante Verminderung ihrer Lebensqualität durch Luftnot, Husten, depressive Verstimmung und Angst [4, 12]. Der Gebrauch von Notfallsprays ist bei Frauen höher als bei Männern.
In der ambulanten Behandlung unterziehen sich Frauen seltener Lungenfunktionstests als Männer. Frauen erhalten in dieser Zeit allerdings häufiger Beratungen hinsichtlich eines Nikotinverzichts und nehmen häufiger an Raucherentwöhnungskursen sowie Patientenschulungen im Rahmen der Disease-Management-Programme (DMP) teil [24]. Frauen profitieren von einem Rauchstopp schneller mit einer verbesserten Lungenfunktion als Männer [23]. Allerdings ist es schwieriger, Frauen längerfristig zum Nikotinverzicht zu bewegen, da z. B. eine Gewichtszunahme befürchtet wird [15]. Wie auch beim Asthma bronchiale wird die Diagnose COPD bei Frauen später gestellt als bei Männern. Die Verordnung inhalativer Steroide erfolgt seltener als bei COPD-kranken Männern, Psychopharmaka werden häufiger verschrieben. Eine Säule der nicht-medikamentösen Therapie der COPD ist die Physiotherapie mit dem Fokus auf Atemtherapie und Konditionsverbesserung. Weibliche COPD-Patienten nehmen solche Therapieangebote signifikant häufiger an als Männer. Ebenso machen Frauen häufiger von dem Angebot der Ernährungsberatung Gebrauch als Männer, wenn sie unter einer chronisch-obstruktiven Lungenerkrankung leiden. Frauen beurteilten die Auswirkung auf den Gesundheitszustand durch eine Sauerstofflangzeittherapie (LTOT) bei höhergradiger COPD signifikant positiver als Männer, berichteten über eine gesteigerte Mobilität und zeigten eine verminderte Mortalität unter dieser Therapie [5, 18].
Lungenkrebs
Lungenkrebs bleibt weiterhin eine der Haupttodesursachen unter den malignen Erkrankungen. Inhalatives Zigarettenrauchen stellt dabei mit Abstand den größten Risikofaktor dar, wobei 90 % aller Männer, jedoch nur 60 % aller Frauen mit Lungenkrebs geraucht haben. Weitere begünstigende Faktoren sind Kontakt mit ionisierender Strahlung, Radon oder Asbest, eine positive Familienanamnese und eine vorbestehende COPD [25]. Aufgrund des verstärkten Rauchverhaltens der Frauen seit dem Ende des letzten Weltkrieges nimmt der prozentuale Anteil an Frauen bei den Neudiagnosen von Lungenkrebs weiterhin stetig zu. Gleiches gilt für die Mortalität. Bei den Männern ist es in den vergangenen Jahren zunächst zu einer Stagnation der Todesfälle durch Lungenkrebs gekommen, aktuell ist in den westlichen Industrieländern sogar ein leichter Rückwärtstrend zu verzeichnen. Dies wird mit dem Erfolg von Aufklärungskampagnen zum Risiko von Tabakkonsum und öffentlichen Rauchverboten in Verbindung gebracht [7].
Bezogen auf den absoluten Nikotinkonsum scheinen Frauen für die Entwicklung eines Lungenkrebses eindeutig benachteiligt zu sein im Vergleich zu Männern: Auch wenn sie nur ein Drittel der Tabakmenge rauchen, haben sie die gleiche Krebswahrscheinlichkeit wie ein rauchender Mann [10]. Mehr als ein Drittel aller nie rauchenden Lungenkrebspatientinnen war passiv Zigarettenrauch ausgesetzt [27].
Unterschiedliche Histologie-Häufigkeiten beim nicht-kleinzelligen Lungenkarzinom
Histologisch werden die Lungenkarzinome nach kleinzelligen und nicht-kleinzelligen Karzinomen (NSCLC) eingeteilt. Die NSCLC erfahren eine weitere Spezifizierung in Plattenepithel- und Nicht-Plattenepithelkarzinome (zumeist Adenokarzinome). Erfreulicherweise sinken die Zahlen der Lungenkrebsneuerkrankungen bei den Männern weiter. Dieser Trend betrifft jedoch nicht die Adenokarzinome, welche in der Anzahl steigend sind. Die Adenokarzinome sind seit Jahrzehnten die häufigsten histologischen Entitäten bei Lungenkrebspatientinnen und steigen bei Frauen in der Anzahl stärker als bei den Männern.
Bei fortgeschrittenem Tumorstadium wird den meisten Patienten eine palliative Chemotherapie angeboten. Frauen weisen im Vergleich zu Männern signifikant häufiger Nebenwirkungen bei dieser Form der Therapie auf, vor allem Fatigue, gastrointestinale Nebenwirkungen, Schmerzen, Mukositis, Depression und Neutropenie. Männer hingegen beklagen häufiger Schluckbeschwerden, ungewollten Gewichtsverlust und Luftnot als Frauen [20, 28].
Seltene Lungenerkrankungen
Die Lungenfibrose ist ein Sammelbegriff für chronisch voranschreitende Lungenerkrankungen mit unterschiedlichen Prognosen. Sie ist die häufigste Form der interstitiellen Lungenerkrankungen, gekennzeichnet durch eine Versteifung der Lunge durch fortschreitende Fibrosierung des Lungengewebes. Hierdurch kommt es zu einer eingeschränkten Oxygenierung des Blutes mit konsekutiven Symptomen wie Luftnot, hartnäckigem Husten, Abgeschlagenheit, Gewichtsverlust, Muskelverspannungen und Trommelschlägelfingern. Hinreichende Faktoren sind Mineralstaubbelastungen, Einnahme bestimmter Arzneimittel, Bestrahlungstherapie und das Vorliegen von Erkrankungen aus dem rheumatologischen Formenkreis. Lungenfibrose tritt häufiger bei Männern als bei Frauen auf, Frauen haben ein besseres Gesamtüberleben als Männer [11].
Die Sarkoidose ist eine Krankheit unbekannter Ursache mit Hauptmanifestationsort Lunge. Klinische Erscheinungsformen der Sarkoidose sind vielfältig und abhängig vom Grad der Entzündung und den betroffenen Organsystemen. Die Erkrankung betrifft häufiger Frauen, allerdings gibt es große regionale Unterschiede in der Prävalenz. Das Hauptmanifestationsalter ist zwischen dem 20. und 40. Lebensjahr für Männer und Frauen, allerdings ist ein zweiter Inzidenzgipfel bei Frauen zwischen dem 45. und 65. Lebensjahr zu verzeichnen [13]. Schätzungsweise 20 bis 50 % aller Sarkoidosepatienten zeigen respiratorische Symptome wie Husten, Brustschmerzen und Luftnot. Typisch sind zudem Abgeschlagenheit, Gelenkschmerzen und das Erythema nodosum. Sarkoidosepatientinnen geben alle genannten Symptome signifikant häufiger an als Männer [8].
Interessenkonflikte: Die Autoren haben keine deklariert.
Erschienen in: Der Allgemeinarzt, 2019; 41 (6) Seite 39-42