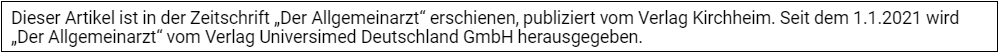Bei Krampfadern (Varikose) gibt es heute – neben der klassischen Stripping-Operation – ein großes Therapie-Repertoire mit minimal-invasiven endovenösen Techniken wie Laser, Radiofrequenz, Verödung oder Kleber. Was sind die Vor- und Nachteile der einzelnen Verfahren?
Eines ist klar: Akute Beinbeschwerden erfordern immer einen umgehenden Thromboseausschluss. Oft sind es aber auch chronische Stauungsbeschwerden und durch Krampfadern bedingte kosmetische Beeinträchtigungen, die vor allem Patientinnen in die Praxis führen. Aber wann ist eine aktive Therapie überhaupt indiziert und welche therapeutische Maßnahme sollte der Arzt dem Patienten am besten anbieten?
Volkskrankheit Varikose
Mit einer Prävalenz von etwa 30 % der erwachsenen Bevölkerung ist das primäre Krampfaderleiden (Varikose) eines der häufigsten Krankheitsbilder in Deutschland [17]. Da die Prävalenz dieser Volkserkrankung mit zunehmendem Lebensalter noch ansteigt, muss man von einer weiteren Zunahme der Varikose – bedingt durch die geburtenstarken Jahrgänge – in den kommenden Dekaden ausgehen.
Als Ursachen für die pathologische Venenerweiterung mit konsekutivem Funktionsverlust von Venenklappen, die der klinisch manifesten Varikose vorausgeht, werden aktuell u. a. genetische Faktoren diskutiert, die zu Störungen des Aufbaus der extrazellulären Matrix (Fibulin-3, Matrix-Metalloproteinasen) führen [8]. Mehr als die Hälfte der betroffenen Patienten zeigen sichtbare Symptome (Ödem, Siderose, Ekzem, Sklerose) der chronisch-venösen Insuffizienz (CVI), ein geringer Prozentsatz das chronische Ulcus (Abb. 1) [17].
Das Ausmaß der Varikose ist nicht immer durch eine rein klinische Untersuchung zu erfassen. Die typischen Stauungsbeschwerden mit Schweregefühl, spannungsartigen Schmerzen und Beinschwellungen zeigen sich v. a. in der warmen Jahreszeit und nehmen im Tagesverlauf zu. Diese Symptome, wie auch die kosmetische Beeinträchtigung, sorgen für einen deutlichen Verlust an Lebensqualität [5].
Die potenziellen Komplikationen der Varikose sind zudem von erheblicher medizinischer und sozioökonomischer Relevanz: Tiefe Beinvenenthrombose, Lungenembolie, postthrombotisches Syndrom, chronisches venöses Ulcus, arthrogenes Stauungssyndrom, sekundäres Lymphödem, erhöhte Empfänglichkeit für Infektionen und Kontaktallergien [7]. Nach neuesten Erkenntnissen ist z. B. das Thromboserisiko bei Varikose-Patienten mindestens um das Fünffache gegenüber nicht betroffenen gleichaltrigen Personen erhöht [4].
Welche Therapieverfahren gibt es?
Heute wendet man präventive, konservative und invasive Therapiemaßnahmen an. Dispositionellen Risikofaktoren wie Adipositas, Bewegungsmangel und/oder einer Arbeit in überwiegend stehender oder sitzender Position sollte man im Sinne der Primär-, Sekundär- und Tertiärprävention konsequent begegnen: durch Gewichtsreduktion, Ausdauersport und das Tragen geeigneter Kompressionsstrümpfe (Kompressionsklasse 1 – 2, je nach Ausprägungsgrad) [29].
Die invasive Therapie der Varikose zielt auf die Beseitigung des Refluxes in Stamm-, Seitenast- und Perforansvenen ab, was sich in der Varianzchirurgie durch die Entfernung der refluxiven Venen, aber auch durch thermische und nicht-thermische endovenöse Ablationsverfahren erreichen lässt (Tabelle 1).
Crossektomie und Stripping
Im Rahmen der klassischen Varizenchirurgie wird die Stammvarikose durch inguinale beziehungsweise popliteale Crossektomie und durch unterschiedliche Stripping-Methoden (invaginierendes Stripping mit der Nabatoff-Sonde, PIN-Stripping oder Kryostripping) behandelt. Seitenastvarizen entfernt man durch Phlebextraktion über kleinste Inzisionen, insuffiziente Perforansvenen zumeist epifaszial ligiert oder diszidiert [3]. Für das Langzeitergebnis ist die Operationstechnik von herausragender Bedeutung. Mittlerweile gilt es als gesichert, dass eine qualitativ einwandfreie Crossektomie – bündige Ligatur mit nicht-resorbierbarem Nahtmaterial im Niveau der tiefen Vene und Verwendung einer Barrieretechnik
z. B. mittels sogenannter Endothelnaht – sowie eine schonende Präparationstechnik unter Einsatz der Tumeszenzlokalanästhesie (TLA)
(Abb. 2) mit einem geringen Risiko für ein Crossenrezidiv einhergeht [9, 16, 19].
Minimal-invasive endovenöse Verfahren
Zu den endovenös thermischen Ablationsverfahren – sie schädigen die Venenwand durch Hitze – zählen die endovenöse Lasertherapie (Abb. 3), die Radiofrequenzablation und die Heißdampfablation. Wegen der Induktion von Temperaturen zwischen 60 und mehr als 100 °C ist eine Anästhesie, zumeist in Form der TLA, erforderlich [10].
Dieses Vorgehen entfällt bei den nicht-thermischen Verfahren, bei denen der Venenverschluss durch einen chemischen Prozess induziert wird. Hierzu zählen die Sklerotherapie mit flüssigem oder aufgeschäumtem Detergens (Lauromacrogol® 400), die mechanochemische Ablation und die Cyanacrylatembolisation (Tabelle 1). Die längste Erfahrung seit Ende der 1990er-Jahre hat man mit der endovenösen Laserablation, für die auch umfangreiche Studien vorliegen [20].
Im Gegensatz zur Crossektomie, bei der eine bündige Ligatur zur tiefen Vene erfolgt und somit der aus dem tiefen Venensystem kommende Reflux mechanisch ausgeschaltet wird, beseitigt man im Rahmen der endovenösen Verfahren in aller Regel "nur" den Ausstrom in das epifasziale Beinvenensystem durch Obliteration der insuffizienten Vene. Ob dies ein methodentechnischer Nachteil ist – verbunden mit einem höheren Risiko von Rezidiv-Refluxen im Crossenbereich –, wird kontrovers diskutiert.
Stellenwert der Therapieverfahren
Die klassische Varizenchirurgie der Stammveneninsuffizienz von V. saphena magna (VSM) und parva mit Crossektomie und Stripping gilt in Deutschland als Standardtherapie [14]. Es wird geschätzt, dass hierzulande derzeit etwa 80 % der Eingriffe an den Stammvenen offen-chirurgisch erfolgen.
Laut einer aktuellen, weltweiten Umfrage unter Venen-Spezialisten werden allerdings die endovenösen Ablationsverfahren – insbesondere die endovenöse Lasertherapie und die Radiofrequenzablation – global zunehmend häufiger eingesetzt als die offene Operation [27]. Dies ist auf Vorteile der minimal-invasiven Verfahren zurückzuführen: geringere Infektionsrate, bessere Lebensqualität in den ersten zwei postoperativen Wochen und schnellere Rekonvaleszenz im Vergleich zum offenen Eingriff [2, 15, 18].
Ein weiterer wichtiger Vorteil der endovenös thermischen Ablationsverfahren ist, dass man diese ohne Unterbrechung einer therapeutischen Antikoagulation sicher und effektiv vornehmen kann [24]. Die klassische Stripping-Operation ist im Gegensatz zu den Kathetertechniken uneingeschränkt anwendbar, also z. B. auch bei post-
phlebitischen Veränderungen, aneurysmatischen Venenerweiterungen (Abb. 2B) oder torquierten Gefäßabschnitten [12].
Der Hauptgrund, warum in Deutschland die endovenösen Therapien weniger häufig eingesetzt werden als etwa in den USA, Großbritannien oder den Niederlanden, dürfte neben der chirurgischen Tradition vor allem an der Vergütung liegen: Nur wenige Kassen tragen bei uns die Kosten für die endovenösen Verfahren.
Aktuelle Studienlage
Die Frage, welchen Stellenwert das einzelne Therapieverfahren hat, und ob es hinsichtlich des individuellen Befunds klare Präferenzen für die eine oder andere Therapiemethode gibt, ist komplex. Bei der Sicherheit und der unmittelbar postoperativen Effektivität sind die endovenöse und die chirurgische Therapie als gleichwertig anzusehen [15].
Im Langzeitverlauf – bis zu fünf Jahre nach dem jeweiligen Eingriff – sind das Wiederauftreten von Krampfadern und die krankheitsbezogene Lebensqualität ebenfalls unabhängig vom Verfahren, wenn man die hitzebasierten Ablationsverfahren mit Crossektomie und Stripping vergleicht [1, 13].
Für die Schaumverödung wurde signifikant häufiger über Rezidive im Sinne einer Wiedereröffnung der behandelten Stammvene berichtet [13, 25]. In einer Studie korrelierte dies auch mit vergleichsweise schlechterer Lebensqualität [26].
Bei der endovenösen Laserablation belegen randomisierte kontrollierte Studien und aktuelle Metaanalysen, dass im Gegensatz zur offenen Op. duplexsonographisch nachweisbare Crossen- und klinische Rezidive aus dem behandelten Operationsgebiet signifikant häufiger auftreten [11, 13, 19, 25]. Das duplexsonographische Rezidiv scheint im Sinne eines Surrogatparameters stark mit dem späteren Auftreten von relevanten Rezidiven zu korrelieren [6].
Für die Patienten ist eine möglichst lange Rezidivfreiheit ein prioritär wichtiges Behandlungsziel [21]. Die aktuelle Literaturlage rechtfertigt es daher, die klassische Operation mit Crossektomie und Stripping weiterhin als Standardtherapie der Stammvarikose, insbesondere der VSM, einzustufen [20]. Man darf allerdings nicht außer Acht lassen, dass es in den vergangenen Jahren erhebliche technische Fortschritte auf dem Feld der endovenösen Verfahren gab, wie etwa die Etablierung längerer Wellenlängen und modifizierter Lichtleiter (z. B. Radialsonde) bei der endovenösen Laserablation (Abb. 3, Tabelle 1),
für die bislang aber keine prospektiven kon-trollierten Studien im Vergleich zur offenen Operation vorliegen. Hier besteht erheblicher Forschungsbedarf. Auch gibt es Hinweise, dass der Erfolg einer endovenösen Therapie von individuellen Merkmalen des Patienten abhängen könnte, wie vom Venendurchmesser (bis zu 9 mm im Mündungssegment) oder vom sogenannten Refluxtyp im Mündungsbereich der großen Stammvene (inkomplette Stammvarikose mit funktionstüchtiger Schleusenklappe) [22, 23, 28]. Dies durch Stratifikation der interessanten Parameter in prospektiven Studien genauer zu untersuchen, könnte helfen, betroffenen Patienten künftig die Option einer evidenzbasierten individualisierten Therapie zu eröffnen.
Invasive Therapie ab wann?
Um Komplikationen und schweren Folgeerkrankungen der CVI entgegenzuwirken, wird in der aktuellen deutschen und europäischen Leitlinie die frühzeitige aktive Therapie der Stammveneninsuffizienz empfohlen, ob operativ oder endovenös [14, 29]. Die Kompressionstherapie ist als Basismaßnahme eingestuft, die den invasiven Therapieverfahren untergeordnet ist oder sie flankiert [29].
Patienten mit Stauungsbeschwerden und/oder einer sichtbaren Varikose und/oder klinischen Zeichen der CVI im Bereich der distalen Unterschenkel und der Füße – Knöchelödem, Corona phlebectatica paraplantaris, Siderose, Ekzem, Dermatosklerose, Ulcus – sollte der Arzt an ein spezialisiertes phlebologisches Fachzentrum überweisen. Dieses Zentrum bietet am besten das gesamte Spektrum der oben genannten Therapieverfahren – operativ und endovenös – an. Die Auswahl der Therapie-
methode sollte sich anhand der beschriebenen Kriterien nachvollziehen lassen. Nur so kann man sicherstellen, dass die Patienten eine dem neuesten Stand der Forschung angepasste optimale Versorgung erhalten. Die Erfahrung des operativen oder interventionellen Therapeuten und die Eingriffsqualität sind hier für das langfristige Therapieergebnis sehr bedeutsam.
Interessenkonflikte: Der Autor hat keine deklariert
Erschienen in: Der Allgemeinarzt, 2019; 41 (1) Seite 60-64