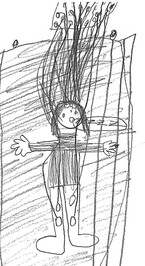Trinkt eine Frau in der Schwangerschaft Alkohol, hat das oft lebenslange, fatale Folgen für das betroffene Kind – von geistigen bis zu motorischen Defiziten. Das fetale Alkoholsyndrom (FAS) kann aber auch zu Schlafstörungen führen, wie aktuelle Daten zeigen.
Der kausale Zusammenhang zwischen dem Alkoholkonsum der Mütter während der Schwangerschaft und der Geburt eines geschädigten Kindes wurde erst im 20. Jahrhundert erkannt [8, 11]. (Äthyl-) Alkohol ist eine psychoaktive Substanz und eine teratogene Noxe, die vor allem das sich in Entwicklung befindliche Gehirn schädigt. Die intrauterine Alkoholschädigung wird heute als Spektrumstörung definiert. Dabei zeigen sich viele Nebensymptome, in variabler Ausprägung aber auch einige Kernsymptome: strukturelle Anomalien, neurokognitive Störungen und Verhaltensauffälligkeiten. In den westlichen Industriestaaten ist die FASD (Fetale Alkoholspektrumstörung) das häufigste, nicht-genetisch bedingte, angeborene Fehlbildungssyndrom [18].
Alkoholkonsum in der Schwangerschaft und FASD
Acht von zehn Frauen trinken während der Schwangerschaft Alkohol (vgl. Tabelle) [4]. Derzeit lässt sich keine Alkoholmenge angeben, die für das ungeborene Kind als ungefährlich bezeichnet werden könnte. Der Arzt muss somit auf die Frage, ob mit einem Glas Sekt auf die Schwangerschaft angestoßen werden darf, mit einem klaren "Nein!" antworten [5].
Die Inzidenz des Fetalen Alkoholsyndroms (FAS) liegt in Deutschland bei 0,5 bis 2 betroffene Neugeborene pro 1.000 Geburten, das sind 600 – 1.200 Neugeborene mit voll ausgeprägtem FAS pro Jahr. Für die gesamte Bandbreite der FASD ist die Häufigkeit bedeutend höher (vier bis sechs betroffene Kinder pro 1.000 Geburten). Jährlich kommen in Deutschland – bei konservativer Schätzung – 3.000 bis 4.000 Neugeborene mit einer Fetalen Alkoholspektrumstörung zur Welt [20]. Zur FASD zählen [2]:- das Fetale Alkoholsyndrom (FAS)
- das partielle Fetale Alkoholsyndrom (pFAS)
- die Alkohol-bedingte entwicklungsneurologische Störung (ARND)
- die Alkohol-bedingte angeborene Malformation (ARBD)
- Kleinwuchs/Untergewicht
- kraniofaziale Dysmorphie, im Sinne auffälliger/diskreter dysmorpher Stigmata im Gesicht
- psychische Störungen mit Hinweis auf strukturelle und funktionelle ZNS-Störungen und
- Alkoholabusus (aktuell oder in der Anamnese) der Mutter während der Schwangerschaft.
Bei Verdacht empfiehlt sich die Vorstellung in einer humangenetischen Sprechstunde oder einer FASD-Fachambulanz [12, 13, 20]. Alkoholkonsum wird in Deutschland gesellschaftlich toleriert, während der Schwangerschaft aber tabuisiert. Bei der Prävention spielt der Allgemeinarzt deshalb eine wichtige Rolle [5].
FASD und Schlaf
Es gibt immer mehr Hinweise, dass Kinder und Jugendliche mit FASD neben kraniofazialen Dysmorphien und multiplen neurophysiologischen Defiziten auch an Schlafstörungen (häufige und anhaltende Ein- und Durchschlafstörungen) [3, 7, 21] sowie am Restless-Legs-Syndrom (RLS) leiden [6]. Studien mittels Polysomnografie (PSG mit Video) wurden bisher bei FASD aber nur wenige publiziert.
Eigene Untersuchung
41 Kinder und Jugendliche mit FASD und Schlafstörungen wurden von 2008 bis 2018 im Schlaflabor der Vestischen Kinder- und Jugendklinik Datteln untersucht (mein Dank geht an die Selbsthilfegruppe FASD Deutschland e.V. für die vertrauensvolle Zusammenarbeit) [17]. Entwicklungsstörungen unterschiedlicher Ausprägung waren bei allen Patienten vorhanden. Bei den Schlafstörungen handelte es sich nach der ICSD-3 [1] um Ein- und Durchschlafstörungen als Hinweis auf eine Insomnie bei 17 von 41 Patienten, um eine Hypersomnie bei einem Teilnehmer, um schlafbezogene Atmungsstörungen bei zwei Personen, um schlafbezogene Bewegungsstörungen bei 15 Patienten (RLS: 12, rhythmische Bewegungsstörungen: 6), um Parasomnien bei 36 Patienten (36 NREM-, 5 REM-Parasomnien), um Schlaf-Wach-Rhythmusstörungen bei 22 und um pathologische EEG-Befunde bei vier Patienten.
In den Diagnosekriterien werden Schlafstörungen, die man zu neurophysiologischen Funktionsstörungen rechnet, nicht explizit genannt [2, 10, 12, 13, 18, 19], demnach liegen bisher zu wenige qualifizierte Publikationen über Schlaf und FASD vor. Die Häufigkeitsangaben zeigen, dass Schlafstörungen bei FASD-Patienten um den Faktor 30- bis 40 häufiger vorkamen als in der Allgemeinpopulation. Alle Schlafprobleme der FASD-Gruppe ließen sich mit den Begriffen und Definitionen der ICSD beschreiben. Das heißt: Es gibt keine exklusiv nur bei FASD vorkommende Schlafstörung. Schlaf-Wach-Rhythmusstörungen und NREM-Parasomnien bildeten die häufigste Kombination von Störungen in der Fallserie. Das gehäufte Auftreten und die nicht-altersgerechte Rückbildung der NREM-Parasomnien weisen auf ein Reifungsdefizit bestimmter ZNS-Strukturen hin sowie auf eine verminderte Stress-Resistenz [14 – 16]. Schlaf-Wach-Rhythmusstörungen geben Hinweise auf eine Störung der Anpassung des inneren Schlaf-Wach- an den äußeren Tag-Nacht-Rhythmus [6, 19].
Interessenkonflikte: keine
Erschienen in: doctors|today, 2021; 1 (10) Seite 24-25